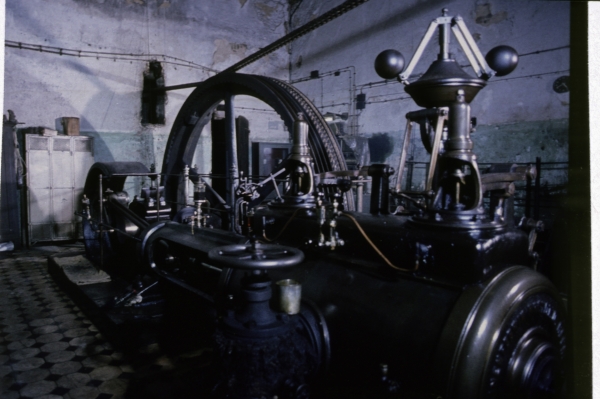Technische Innovationen führen zu strukturellen Veränderungen im Handwerk: Um 1900 hatten Heimarbeit und handwerkliche Berufe noch eine große Bedeutung, nach dem Zweiten Weltkrieg nahm diese in vielen Arbeitsbereichen ab.
Spezialisierung von Berufen

Messerproduktion im arbeitsteiligen Handwerk: der Schalenschleifer produziert nur die Griffe. Langenfeld-Wiescheid, 1989.
Photo: Ayten Fadel/LVR
Im Zuge fortschreitender Technisierung verlagerte sich eine Vielzahl handwerklicher Tätigkeiten auf die Industrie, wodurch einige jahrhundertealte handwerkliche Berufsgruppen, wie beispielsweise die der Gerber, nahezu bedeutungslos wurden. Andere Handwerke differenzieren sich dagegen bis heute weiter aus, insbesondere Berufe im Baugewerbe. So entstand beispielsweise um 1900 aus dem Schmiedehandwerk das Schlosserhandwerk, womit dieser neue Berufszweig auf zeitgenössische technische Herausforderungen reagierte. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten sich dann gleich mehrere heutzutage etablierte Berufe wie der des Maschinenbauers, Kraftfahrzeugbauers, Autoschlossers, Klempners, Installateurs, aber auch eine Vielzahl von Mechanikerberufen. Eine solche Ausdifferenzierung und zugleich Spezialisierung des Berufsbildes und der geforderten Tätigkeiten ist auch bei Handwerksberufen aus dem Dienstleistungssektor, wie beispielsweise dem des Friseurs, festzustellen.
Unterschiede zwischen Handwerk und Industriearbeit

Feilenhauer beim Einschlagen von Kerben in den Rohling. Eschweiler, 1986.
Photo: Peter Weber/LVR
Der Unterschied zwischen industrieller und handwerklicher Fertigung liegt nicht nur in der eigentlichen Herstellung, sondern darin, dass das Aufgabengebiet eines Handwerkers wesentlich breiter gefasst ist als die jeweiligen industriellen Produktionsschritte einer Ware. Dieses personelle Tätigkeitsfeld umfasst neben der Herstellung von Artikeln nämlich zudem auch die Wartung, Reparatur oder die Modifizierung und Individualisierung eines Einzelprodukts auf Kundenwunsch. Ein Handwerker erledigt in der Regel alle unterschiedlichen Arbeitsschritte der Herstellung und Wartung, während in der Industrie die Tätigkeiten auf verschiedene Arbeiter und Maschinen verteilt werden. Dadurch arbeiten in der Industrie häufig angelernte Arbeiter, während ein Handwerk in Ausbildung gelernt wird. Eine zwei- bis dreijährige Ausbildung wird dabei in der Regel in einem produzierenden Betrieb absolviert. Nur ein kleinerer Teil der Handwerksberufe, vor allem in Heimarbeit verrichtetes Arbeiten wie die der Korbflechter, konnte auch ohne generalisierte Ausbildung durch die Anleitung in einem produzierenden Betrieb erlernt werden. Zunehmend setzte sich im 20. Jahrhundert die Ausbildung durch, welche vorrangig an einer Fachhoch- oder Berufsschule absolviert wird und nur eine flankierende Betreuung in einem Lehrbetrieb hat. Die Praxisanteile sind dabei je nach Lehre unterschiedlich stark gewichtet.
Der Rückgang einzelner Handwerksberufe

Stellmacher beim Anbringen von Speichen. Keidelheim 2005.
Photo: Josef Mangold/LVR
Die Verbreitung einiger handwerklicher Berufe ging im Zuge veränderter Arbeits- und Lebensumstände im Laufe des 20. Jahrhunderts stark zurück. Die Produkte waren nicht mehr nachgefragt oder technische Möglichkeiten, neue Materialien sowie industrielle Herstellungsprozesse lösten die handwerkliche Arbeit ab. Beispiele hierfür sind die Berufe des Drechslers, der um die Jahrhundertwende unter anderem Spinnräder für den Heimgebrauch produzierte, des Fässer oder Bottiche herstellenden Küfers oder auch der des Korbflechters. Der noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts für nahezu alle Handwerksbereiche, Händler oder Landwirte unentbehrliche Stellmacher, der Räder und landwirtschaftliche Geräte aus Holz herstellte, verschwand als Beruf fast vollständig. Spezialisierte Handwerker, die beispielsweise Mäusefallen, Blitzableiter, Knöpfe, Schneidwaren oder Kokosmatten herstellten, machten das Rheinland mit ihren Produkten auch überregional bekannt. Doch auch ihre Bedeutung sank im 20. Jahrhundert. Heute leben nur noch wenige Handwerker von solchen Produkten und verkaufen diese eher auf regionalen oder historisierenden Märkten, denn im Alltag wurden ihre Erzeugnisse meist durch industriell hergestellte Ware abgelöst.